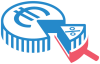Wer vom Erblasser per Testament von der gesetzlichen Erbfolge ausgeschlossen und damit enterbt wird, hat immerhin noch Anspruch auf den sogenannten Pflichtteil. Den Pflichtteilsanspruch muss der Berechtigte gegenüber dem Erben geltend machen, im Gegenzug kann dieser den Pflichtteil als Nachlassverbindlichkeit abziehen. Verzichtet der Pflichtteilsberechtigte darauf, greift für den Erben eine Steuerbefreiung. Allerdings nur, wenn der Verzicht auf den Pflichtteilsanspruch rechtzeitig erklärt wird.
Wer einen Pflichtteil geltend machen kann
Anspruch auf einen Pflichtteil können haben: Kinder, Eltern, Ehegatte und entferntere Abkömmlinge des Erblassers (also zum Beispiel Enkel und Urenkel).
Voraussetzung für einen Pflichtteilsanspruch ist, dass der Erblasser eine oder mehrere dieser Personen per Testament von der gesetzlichen Erbfolge ausgeschlossen hat. Trotz der Enterbung gehen sie aber nicht leer aus. Denn sie können von dem oder den Erben den sogenannten Pflichtteil verlangen.
Die Pflichtteilsberechtigten haben Anspruch auf die Hälfte des Wertes, den der gesetzliche Erbteil gehabt hätte (§ 2303 BGB).
Der Pflichtteil ist ein reiner Geldanspruch. Ein Anspruch auf bestimmte Teile des Nachlasses oder eine Beteiligung am Nachlass selbst besteht also nicht.
Beispiel:
Der Erblasser enterbt seinen Sohn Hans und setzt seine Tochter Manuela mit Testament als alleinige Erbin ein. Das Erbe besteht aus einem Mehrfamilienhaus mit einem Wert von 800.000 Euro. Der Pflichtteil beträgt 200.000 Euro (= 50 % von 800.000 Euro, davon 50 %).
Hans kann von seiner Schwester Manuela die Zahlung dieses Betrags verlangen. Er wird aber nicht zu einem Viertel Miteigentümer des Mehrfamilienhauses. Alleinige Eigentümerin ist seine Schwester Manuela.
Auch entferntere Abkömmlinge des Erblassers, also zum Beispiel Enkel oder Urenkel, können grundsätzlich pflichtteilsberechtigt sein. Allerdings besteht hier ein Pflichtteilsanspruch nur, wenn sie auch Erben sein könnten – wären sie nicht per Testament von der gesetzlichen Erbfolge ausgeschlossen (§ 2309 BGB, § 1924 BGB). Das Gleiche gilt für die Eltern des Erblassers, sollten diese noch leben.
Beispiel:
Der Erblasser enterbt seine Tochter Paula und setzt per Testament als Erben seinen Sohn Manuel ein. Paula ist pflichtteilsberechtigt. Im Rahmen der gesetzlichen Erbfolge würde sie ihre Kinder Susanne und Kathrin als Erben ausschließen (§ 1924 Abs. 2 BGB). Damit sind Susanne und Kathrin, also die Enkel des Erblassers, nicht pflichtteilsberechtigt.
Abwandlung:
Paula ist bereits verstorben, deshalb enterbt der Erblasser ihre Kinder Susanne und Kathrin. In diesem Fall sind die Enkel pflichtteilsberechtigt, denn sie würden bei gesetzlicher Erbfolge anstelle ihrer Mutter Paula erben (§ 1924 Abs. 3 BGB).
Was passiert, wenn der Pflichtteil geltend gemacht wird?
Der Anspruch auf den Pflichtteil entsteht zivilrechtlich automatisch bereits mit dem Tod des Erblassers (§ 2317 Abs. 1 BGB).
Für die Erbschaftssteuer ist dagegen entscheidend, wann der Pflichtteilsanspruch geltend gemacht wird (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG). Denn erst, wenn der Pflichtteilsberechtigte seinen Anspruch auf den Pflichtteil geltend macht, liegt bei ihm ein Erwerb von Todes wegen vor. Dieser ist grundsätzlich steuerpflichtig, der Berechtigte darf jedoch den persönlichen Freibetrag abziehen.
Sobald der Berechtigte seinen Pflichtteil beansprucht, entstehen dadurch beim Erben Nachlassverbindlichkeiten, da er ja den geltend gemachten Pflichtteilsanspruch erfüllen muss (§ 10 Abs. 5 Nr. 2 ErbStG). Vor Geltendmachung des Pflichtteils ist kein Abzug als Nachlassverbindlichkeit möglich.
Und wenn der Pflichtteilsanspruch nicht geltend gemacht wird?
Solange also der Pflichtteilsberechtigte seinen Anspruch auf den Pflichtteil nicht geltend gemacht hat, liegt bei ihm noch keine Bereicherung bzw. kein steuerpflichtiger Erwerb vor und es entsteht bei ihm auch noch keine Erbschaftssteuer (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 b ErbStG).
Verzichtet der Pflichtteilsberechtigte auf seinen Pflichtteil, muss der Erbe den entsprechenden Geldanspruch nicht erfüllen. Der nicht geltend gemachte Geldbetrag verbleibt damit beim Erben, der sich im Ergebnis über ein ungeschmälertes Erbe freuen kann. Der Verzicht auf den Pflichtteil durch den Berechtigten begünstigt den Erben – und führt deshalb zu einer eigentlich steuerpflichtigen Schenkung. Aber: Dieser Erwerb des Erben vom Pflichtteilsberechtigten ist vom Gesetz steuerfrei gestellt worden (§ 13 Abs. 1 Nr. 11 ErbStG). Die Steuerbefreiung verhindert letztlich, dass die Schenkung des Pflichtteilsberechtigten an den Erben zusätzlich zum Erbe versteuert werden muss.
Beispiel:
Konstanze ist von ihrer Mutter Adelheid als Alleinerbin per Testament eingesetzt worden. Das Barvermögen von Adelheid beträgt 60.000 Euro. Konstanzes Bruder Konrad hat lediglich Anspruch auf den Pflichtteil. Er könnte also von Konstanze einen Betrag in Höhe von 15.000 Euro verlangen (= 50 % von 60.000 Euro, davon 50 %).
Konrad verzichtet jedoch auf die Geltendmachung des Pflichtteils. Damit liegt der steuerpflichtige Erwerb für Konstanze weiterhin bei 60.000 Euro. Durch den Verzicht auf den Pflichtteil in Höhe von 15.000 Euro schenkt Konrad seiner Schwester diesen Betrag. Diese Schenkung ist jedoch steuerfrei.
Im Ergebnis bleibt es damit für Konstanze bei einem steuerpflichtigen Erwerb von 60.000 Euro. Auf diesen ist der persönliche Freibetrag anwendbar. Da dieser für Konstanze 400.000 Euro beträgt, fällt letztlich keine Erbschaftssteuer an.
Pflichtteil geltend gemacht und dann doch verzichtet: steuerlich keine gute Idee
Der Gesetzeswortlaut ist in diesem Fall ziemlich eindeutig: „Die Steuer entsteht […] für den Erwerb eines geltend gemachten Pflichtteilsanspruchs mit dem Zeitpunkt der Geltendmachung“ (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 b ErbStG).
Das bedeutet: Sobald der Pflichtteilsberechtigte seinen Anspruch auf den Pflichtteil geltend macht, liegt bei ihm ein steuerpflichtiger Erwerb vor – und beim Erben entfällt gleichzeitig die Steuerbefreiung nach § 13 Abs. 1 Nr. 11 ErbStG.
Ein nachträglicher Verzicht des Pflichtteilsberechtigten auf seinen Anspruch, also nachdem er diesen geltend gemacht hat, wirkt sich grundsätzlich nicht auf die Erbschaftssteuer aus. Das heißt, auch wenn der Pflichtteilsberechtigte auf sein Geld verzichtet, liegt ein steuerpflichtiger Erwerb vor, der der Erbschaftssteuer unterliegt.
Praxistipp:
Der Erbe kann den geltend gemachten Pflichtteilsanspruch immer als Nachlassverbindlichkeit abziehen. Voraussetzung für die Abzugsfähigkeit ist nämlich lediglich die Geltendmachung, nicht die Erfüllung der Geldschuld. Ob das Geld tatsächlich fließt oder der Berechtigte darauf verzichtet, spielt keine Rolle.
Es ergibt sich noch eine weitere negative Folge, diesmal für den Erben. Denn: Der Verzicht auf einen geltend gemachten Pflichtteilsanspruch stellt eine Zuwendung des Pflichtteilsberechtigten an den Erben dar. Und diese unterliegt der Schenkungssteuer. Zwar gelten auch hier die persönlichen Freibeträge, die jedoch unter Umständen nicht ausreichen, damit der geschenkte Pflichtteil steuerfrei bleibt.
Achtung:
Die Steuerbefreiung nach § 13 Abs. 1 Nr. 11 ErbStG kann nach der Geltendmachung des Pflichtteils nicht mehr in Anspruch genommen werden.
Beispiel:
Max hat sich mit seinem Vater und seinem Bruder Moritz zerstritten. Als der Vater stirbt, erbt Moritz als Alleinerbe durch Testament. Max erhebt sofort schriftlich durch seinen Anwalt Anspruch auf seinen Pflichtteil in Höhe von 500.000 Euro. Nachdem sich die Brüder versöhnt haben, verzichtet Max auf die Erfüllung des Pflichtteils.
Da Max seinen Pflichtteilsanspruch geltend gemacht hat, liegt dadurch bei ihm bereits ein steuerpflichtiger Erwerb von 500.000 Euro vor. Dass er auf die Auszahlung und damit auf die Erfüllung des Anspruchs verzichtet hat, spielt für die Entstehung der Erbschaftssteuer keine Rolle.
Moritz kann den geltend gemachten Pflichtteilsanspruch als Nachlassverbindlichkeit abziehen, auch wenn er ihn nicht erfüllen muss. Gleichzeitig liegt aber auch in Höhe von 500.000 Euro eine steuerpflichtige Schenkung vor (für die die Steuerbefreiung nach § 13 Abs. 1 Nr. 11 ErbStG nicht mehr in Anspruch genommen werden kann).
Hätte Max den Pflichtteil vor dem Verzicht nicht geltend gemacht, müsste er keine Erbschaftssteuer zahlen (sein persönlicher Freibetrag in Höhe von 400.000 Euro reicht nämlich nicht aus, um den steuerpflichtigen Erwerb abzudecken). Und bei Moritz würde keine steuerpflichtige Schenkung vorliegen (für die im Übrigen nur ein persönlicher Freibetrag von 20.000 Euro gilt, da es sich um eine Schenkung unter Geschwistern handelt). Mit einem Verzicht auf den Pflichtteil vor dessen Geltendmachung wären beide steuerlich günstiger gefahren.
Fazit: Wenn Verzicht, dann vor Geltendmachung
Die Steuerbefreiung und die weiteren möglichen steuerlichen Folgen hängen von der Geltendmachung des Pflichtteilsanspruchs ab. Will der Berechtigte auf seinen Pflichtteil verzichten, sollte der Verzicht unbedingt vor der Geltendmachung erfolgen. Sonst drohen steuerliche Nachteile.
Geltendmachung bedeutet das „ernstliche Verlangen auf Erfüllung des Anspruchs gegenüber dem Erben“. Ob sie vorliegt, muss im Einzelfall aufgrund der jeweiligen Umstände geprüft werden. Wer zum Beispiel durch einen Anwalt schriftlich erklären lässt, dass man den gesetzlichen Pflichtteil ausgezahlt haben möchte, erfüllt in jedem Fall die Kriterien einer Geltendmachung. Ob die Höhe des Pflichtteils genannt wird, ist unerheblich. Wer sich dagegen lediglich über den Inhalt des Testaments und die Höhe des möglichen Pflichtteils erkundigt, hat die Grenze zur Geltendmachung meist noch nicht überschritten. Aber wie gesagt, es kommt auf die jeweiligen Umstände des Einzelfalls an (BFH, Urteil vom 19.7.2006, II R 1/05).
Wer sich noch nicht sicher ist, ob er den Anspruch geltend machen möchte, und erst einmal Auskunft über die Vermögenswerte haben will, sollte entsprechende Erklärungen gegenüber dem oder den Erben sorgfältig formulieren. Nicht, dass unbeabsichtigt die Erbschaftssteuerpflicht ausgelöst und eventuell im Nachgang eine steuerpflichtige Schenkung verursacht wird.